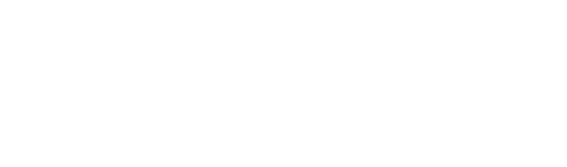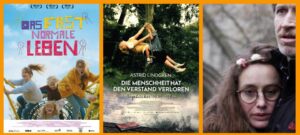Mit dem mit 5.000 € dotierten Marburger Kamerapreis 2019 wurde vergangenes Wochenende ein legendärer Kameramann des jungen deutschen Films ausgezeichnet.
Thomas Mauch hat seit Ende der 1950er Jahren zahlreiche Filme u.a. von Alexander Kluge, Edgar Reitz, Werner Schroeter und Werner Herzog visuell gestaltet. Er war ebenfalls der Bildgestalter vieler Regisseurinnen wie Ula Stöckl, Helma Sanders-Brahms oder Pia Frankenberg. Mauch wird gern als das Auge des neuen deutschen Films bezeichnet. Viele seiner Assistentinnen und Assistenten wurden später selbst anerkannte Bildgestalter wie Judith Kaufmann, die vor einigen Jahren selbst in Marburg ausgezeichnet wurde. Kamerafrau Anna Crotti würdigte ihn in ihrer sehr persönlich gehaltenen Laudatio. Jürgen Kasten (VG Bild-Kunst) lobte in seinem Grußwort das beeindruckende Engagement des anwesenden „Boot“-Kameramanns Jost Vacano, der in mehreren Prozessen dafür gekämpft hat, an den Umsätzen dieses Welterfolges beteiligt zu werden.
Der Marburger Kamerapreis (www.marburger-kamerapreis.de) wurde zum 19. Mal von der Universität und der Stadt Marburg vergeben. Dazu gehören die Kameragespräche, bei denen ausgewählte Filme des Preisträgers mit ihm aus verschiedenen Perspektiven diskutiert werden. In diesem Jahr übernahmen diese Aufgabe der Filmwissenschaftler Florian Krautkrämer, der Kameramann Rüdiger Laske und die Filmkritikerin Hannah Pilarczyk von Spiegel Online, die auch im Kuratorium vom Haus des Dokumentarfilms sitzt. Durch diese tiefergehende Auseinandersetzung mit den von Mauch gedrehten Filmen bekamen die Zuhörer einen guten Einblick in seine Herangehensweise. Wichtig ist ihm eine gute Zusammenarbeit mit der Regie, die gerne auch seine Vorschläge für die visuelle Gestaltung übernehmen darf. Wenn man einige seiner Filme noch einmal sieht, wird seine Liebe zum Dokumentarischen deutlich. Sehr spannend beispielsweise das Porträt „Zum Beispiel Bresson“ (1967) von Theodor Kotulla, Martin Ripkens und Hans Stempel, die dem französischen Meister dank Mauchs Kameraarbeit sehr nahekommen.
Er hat nicht nur sehr viele Dokumentarfilme mit verschiedenen Filmemachern gedreht, sondern auch in seinen Spielfilm gibt es immer wieder wichtige dokumentarische Momente. Dies gilt ganz klar für „Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos“ (1967) von Alexander Kluge. In dem feministischen Film „Neun Leben hat die Katze“ (1968), dem Abschlussfilm von Ula Stöckl am Ulmer Filminstitut, bei dem Mauch als Dozent unterrichtete, gibt es sehr starke Bilder, in denen der Alltag im München der 1960er Jahre gezeigt wird. Höhepunkt ist sicherlich die Bruchlandung eines Senkrechtstarters der Bundeswehr, die geschickt in die Geschichte eingebaut wird. Auch in „Neapolitanische Geschwister“ (1978) von Werner Schroeter gibt trotz aller theatralischen Überhöhung und opernhaften Inszenierung immer wieder beeindruckende dokumentarische Aufnahmen, beispielsweise in der Fischhalle oder von einer prunkvollen Begräbniskutsche, die von sechs schwarzen Rössern durch die Stadt gezogen wird. In „Unter dem Pflaster ist der Strand“ (1975) von Helma Sanders-Brahms folgt die Kamera der Protagonistin Grischa auf eine Demonstration gegen den § 218, die auf einer real stattgefundenen Demonstration gedreht wurde. Möglich ist dies durch seinen Stil einer bewegten und begleitenden Kamera, und dass er sich schnell auf die jeweilige Situation einstellt.
Er hat quasi die Forderungen von „Dogma 95“ der dänischen Regisseure Lars von Trier und Thomas Vinterberg vorweggenommen, Spielfilme mit dokumentarischen Mitteln zu drehen. Diese Herangehensweise machte ihn interessant für viele Filmemacherinnen und Filmemacher des neuen deutschen Films. Höhepunkt der Kameragespräche war sicherlich seine Aussage, Werner Herzogs „Aguirre, der Zorn Gottes“ (1972) sei eigentlich ein Dokumentarfilm, denn er habe sich den Naturgewalten des Dschungels und des Flusses ausgesetzt und Herzog habe wenig Möglichkeiten der Inszenierung gehabt. Wenn man mal von Klaus Kinski absieht, der sich selbst gern ins rechte Licht rückte und perfekt mit der Kamera agiert habe. Auf dem Floß habe er intuitiv auf die Situation reagiert und sei auch der einzige gewesen, der dort nicht gesichert gewesen sei. Das hätte seine Bewegungsfreiheit zu sehr eingeschränkt. Die Jury des Marburger Kamerapreises würdigte ihn folgendermaßen: „Thomas Mauch hat sich in seiner reichhaltigen bildkünstlerischen Tätigkeit niemals dem Massengeschmack angebiedert und ist auch keinen aktuellen Moden blind gefolgt. Dabei hat er einen herausragenden Korpus an Filmen visuell gestaltet und sich so nachhaltig um die deutsche Filmkultur verdient gemacht.“