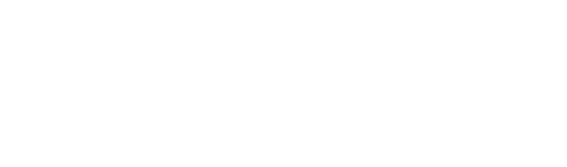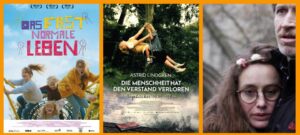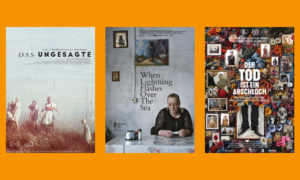Das Haus des Dokumentarfilms gratuliert Cem Kaya. „Aşk, Mark ve Ölüm – Liebe, D-Mark und Tod“ wurde beim Preis der deutschen Filmkritik als bester Dokumentarfilm und für die beste Montage ausgezeichnet. Die Verleihung fand am 19.2.2023 in Berlin statt.
Als einziger deutscher Filmpreis, der ausschließlich von Kritiker:innen vergeben wird, zeichnet der Preis der deutschen Filmkritik seit 1956 deutsche Produktionen aus, die rein nach künstlerischen Kriterien bewertet werden. Wirtschaftliche, länderspezifische oder politische Kriterien spielen keine Rolle. Über die Vergabe entscheiden Jurys aus Mitgliedern des VdFk. Cem Kayas Dokumentarfilm „Aşk, Mark ve Ölüm – Liebe, D-Mark und Tod“ (Produktion: Filmfaust und Film Five mit WDR/Arte und rbb; Redaktion: Jutta Krug, WDR) konnte in den Kategorien „Bester Dokumentarfilm“ und „Beste Montage“ überzeugen.
Das sagt die Jury des VdFk
„Der Film ist eine Wucht; wie er aufwendig zusammenrecherchierte Archivaufnahmen und kurze Interview-Auftritten der Größen des Genres montiert zu einer wechselvollen Geschichte türkischer Migration, ist atemberaubend. So ist Cem Kayas Film einerseits ein kluger, politischer Film und andererseits ein Blockbuster über die Kraft von Musik, der sich niemand entziehen kann“, heißt es in der Jury-Begründung. Der Verband weiß zudem die Kraft des Filmschnitts zu würdigen: „Die Montage konfrontiert uns mit uns selber, sie hält uns den Spiegel vor […] Plötzlich sehen wir uns, wie wir sind – und manchmal überhaupt nicht sein wollen“, so die Jury zur Montage als „Zeigekunst“, aber auch als „Kunst des Rhythmus‘ und der engen Harmonie mit der Musik“.
Über „Aşk, Mark ve Ölüm – Liebe, D-Mark und Tod“
Cem Kayas Dokumentarfilm „Aşk, Mark ve Ölüm – Liebe, D-Mark und Tod“ folgt der Entwicklung der türkischen und teils auch kurdischen Musik- und Einwandererkultur in Deutschland über mehrere Generationen, beginnend Anfang der 1960er Jahre. Die Erinnerung an migrantische Erfahrungen verknüpft er dabei klug mit interkultureller Musikgeschichte. Zu sehen (und hören) ist die Verwurzelung in der Tradition, aber auch, wie sich der Stil über die Jahre wandelt, indem er moderne Einflüsse aufnimmt und verarbeitet. Es entstehen hybride Klang- und Lebenswelten, die irgendwo zwischen der türkischen und deutschen Kultur angesiedelt sind.
Bei Kinostart war der Filmemacher zweimal Gast der DOK Premieren vom Haus des Dokumentarfilms. Beim Branchentreff DOKVILLE 2022 wurde „Aşk, Mark ve Ölüm – Liebe, D-Mark und Tod“ in einem Video vorgestellt. Im Gespräch mit Frank Rother vom HDF verrät der Regisseur mehr über das Konzept seines Dokumentarfilms.