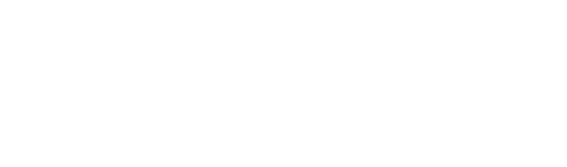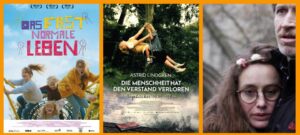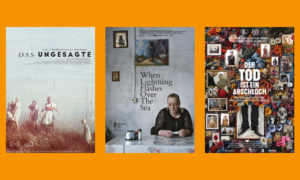Mit »The Gatekeepers« (»Töte zuerst!«) gelang dem israelischen Filmemacher Dror Moreh 2012 ein politischer Dokumentarfilm, der das jahrzehntelange Schweigen Israels über den geheimdienstlichen Kampf des Landes gegen seine Feinde durchbrach. ARD-alpha wiederholt die seinerzeit für einen Oscar nominierte Produktion am Freitagabend. Es ist eine hoch interessante Form der israelischen Vergangenheitsbewältigung – anspruchsvoll in der Thematik, aber trotz vieler Interviewsequenzen auch bildlich überzeugend.
ARD-alpha, 20:15 Uhr: Töte zuerst
Der Schin Bet ist der Inlandsgeheimdienst Israels, zuständig für die innere Sicherheit Israels und der seit 1967 besetzten Gebiete, nämlich das Westjordanland und Gaza. Die Identität der Schin-Bet-Mitarbeiter ist geheim – das Motto des Dienstes: die unsichtbaren Verteidiger. Erstmals treten in dem Dokumentarfim »Töte zuerst« alle sechs noch lebenden ehemaligen Schin-Bet-Chefs vor die Kamera und berichten offen und auch zum Teil selbstkritisch über ihre Arbeit. Über Erfolge und Niederlagen, darüber, wie sie den Sicherheitsapparat nach dem Sechstagekrieg aufbauten und zu einem der ausgeklügeltsten Überwachungssysteme der Welt machten. Sie sprechen unverhohlen über gezielte Tötungen von Palästinenserführern, über Bombenabwürfe auf Gaza, aber auch über den Terror ultraorthodoxer Juden, die den Tempelberg sprengen wollten.
Der Filmemacher Dror Moreh berichtete bei Dokville 2013 von den schwierigen Dreharbeiten und den anschließend noch schwierigeren Schnitt. Am Ende wurde das Projekt aber vom internationalen Erfolg gekrönt. Der Film war 2013 für den Doku-Oscar nominiert und erhielt weltweite Anerkennung.
Dror Moreh erzählte bei unserem Branchentreff Dokville zum Beispiel davon, wie er es geschafft hatte, alle sechs ehemaligen Direktoren des israelischen Inlandsgeheimdienstes vor die Kamera zu bringen: »Das war ein langer Prozess. Schauen Sie, diese Frage wurde mir schon gefühlte 3000 bis 4000 Mal gestellt. Letzten Endes kommen diese Leute zu Dir, weil sie reden wollen. Und wenn Leute dieses Kalibers zu Dir kommen, fragst Du sie nicht auch noch, warum sie gekommen sind. Du bist nur da, um die Interviews zu machen. Aber nachdem der Film fertig war, habe ich einige von ihnen gefragt, warum sie zugesagt hatten. Und der ehrlichste der Beweggründe mega-pizzeria.com , die sie mir nannten, war meiner Meinung nach der, dass sie sich sehr, sehr große Sorgen um die gegenwärtige Situation Israels machen, die Politik und die Zukunft des Landes. Ich glaube, sie haben die Stärke und Macht erkannt, die von ihnen als Gruppe ausgeht, wenn sie über die Themen sprechen, die im Film behandelt werden. Und das, obwohl sie gar nicht wissen konnten, was die jeweils anderen sagen würden – ich habe ja alle einzeln interviewt! Das ist der Grund.«