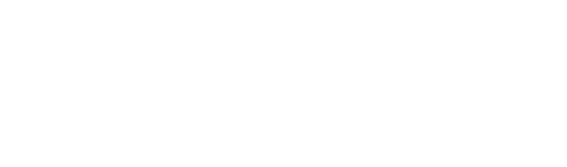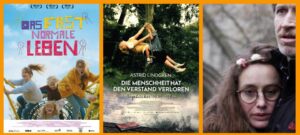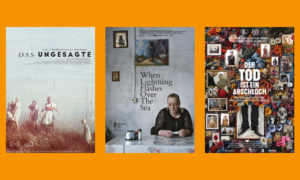In »Wild Plants« (am Montagabend als Erstausstrahlung bei Arte) sucht Filmemacher Nicolas Humbert nach der Verbindung zwischen Pflanzen und Menschen. »Wir sind auch Pflanzen«, heißt es an einer Stelle. Es dauere nur 70 bis 100 Jahre. Die Protagonisten sind in den Augen des Regisseurs selbst so etwas wie »Pionierpflanzen« – in der Wildnis des Urbanismus sprießende Individualgewächse.
Arte, 23:45 Uhr: Wild Plants
Der Film hat sehr ruhige, zum Teil poetische Bilder wie gleich zu Beginn der Hund, der mit seinen Pfoten ganz wild auf einer Eisfläche kratzt. Es ist Nicolas Humberts eigener Hund, der dies regelmäßig mache. Was er unter dem Eis suche, bleibe eine spannende Frage. In »Wild Plants« geht es um wilde Pflanzen, aber ebenso um Menschen, die sich um sie kümmern. In den heutigen zerstörerischen Zeiten findet es Nicolas Humbert umso wichtiger, positive Aspekte zu zeigen, bei denen sympathische Menschen eigenwillige Lösungen für ihre Leben finden. Er selbst sieht sich als Romantiker, den eher das Positive interessiere. Seine Protagonisten seien so etwas wie Pionierpflanzen, die ein neues Gelände erobern. Ein französischer Kollege habe auch den Film eine solche Pionierpflanze genannt, was ihn sehr gefreut habe. Natürlich gibt es auch in Deutschland Initiativen für Urban Gardening oder Solidarischer Landwirtschaft. Aber für seine Filme gehe er gern in der Ferne und letztendlich entscheide sein Bauchgefühl, welche Menschen nachher in seinem Film aufgenommen würden.
In »Wild Plants« konzentriert er sich auf den indianischen Philosophen Milo Yellow Hair. In Zürich ist seit über 20 Jahren Maurice Maggi unterwegs und säht auf Verkehrsinseln und Brachgeländen Samen aus, die er akribisch in einem Plan einzeichnet. Seine Stellen besucht er regelmäßig bei seinen Spaziergängen durch die Stadt – auch um Samen für neue Aktionen zu sammeln. Zu Beginn wurde diese wilde Begrünung bekämpft, inzwischen wird der Anarchist zu Hearings über Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung eingeladen. Er hat ein Buch zur essbaren Stadt veröffentlicht. In Genf pflanzt eine Gruppe junger Menschen in der Einflugschneise des Flughafens Obst- und Gemüse für die Städter, die sie dabei unterstützen. Das Paar in Detroit habe er durch Zufall gefunden. Diese Stadt sei ein Phänomen, da sie sich sehr in die Weite ausgebreitet habe. Zu Hochzeiten der Autoindustrie habe Detroit rund 2 Mio. Einwohner gehabt. In der Krise hätten viele die Stadt verlassen und inzwischen hat sie nur noch rund 600.000 Einwohner. Viele Häuser stehen leer und können sehr günstig für ein paar tausend Dollar gekauft werden, was einige alternative Gruppen für neue Projekte genutzt haben. Sie waren sozusagen Pionierpflanzen für ein neues Detroit. Dies hat inzwischen wieder das Interesse von Spekulanten an der Stadt geweckt. Aufnahmen beispielsweise mit dem Avantgardefilmer Jonas Mekas in New York haben es dann doch nicht in den Film geschafft.
Die erste Idee für den Film hatte Humbert 2010, doch die Finanzierung eines solch individuellen Autorenfilms sei inzwischen sehr schwierig und habe letztlich über drei Jahre gedauert. Mit einem Jahr im Schnitt wollten er und seine Cutterin Simone Fürbringer sich bewusst Zeit dafür lassen, den richtigen Stil und Rhythmus zu finden. Die poetische Kraft des Lebens bei seinen Protagonisten sollte eine Entsprechung in der filmischen Form finden. Die Tongestaltung und die Verknüpfung mit der Musik brauchten ebenfalls ihre Zeit. Viele der Töne mussten für die optimale Mischung fürs Kino neu gestaltet und mit Geräuschen aus dem Archiv ergänzt werden.
Ganz bewusst wurde auf einen wissenden Kommentar verzichtet, damit das Publikum die Freiheit hat, den Film selbst zu interpretieren und ihn sich anzueignen. Gedreht wurde mit kleinem Team mit Kamerafrau Marion Neumann und Tonmann Jean Vapeur. Der Film ist digital gedreht, doch seine ruhige Bildgestaltung orientiert sich am 35 mm Film. Aus seinen bisherigen Filmen wie »Step across the Boarder« (1990) oder »Middle of the Moment« (1995) weiß er, das solche Filme eine lange Wirkung und Nachfrage haben können.