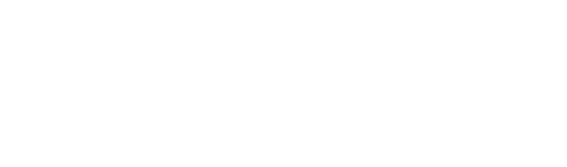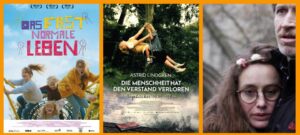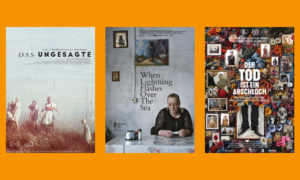Beim DOK.forum auf dem Münchener Dokumentarfilmfestivals präsentierten Inga Selck, Prof. Dr. Ursula von Keitz, Prof. Dr. Thomas Weber und Dr. Kay Hoffmann in der HFF München die filmographische „Datenbank zur Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland 1945 – 2005“ (www.db.dokumentarfilmgeschichte.de), die mit rund 15.000 Datensätzen als die bislang umfassendste Datenbank zu dokumentarischen Filmen aus Deutschland bezeichnet werden kann.
Kernstück der systematischen Datenerfassung sind Filme, die zwischen 1945 und 2005 im Kino angelaufen sind, auf Festivals gezeigt oder auf herausgehobenen Programmplätzen im deutschen Fernsehen gesendet wurden. Die Metadaten der Filme wurden im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Langzeitforschungsprojekts „Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland 1945 – 2005“ erfasst, das mit dieser Datenbank der Öffentlichkeit ein wichtiges Recherchetool zur Verfügung stellt. Es ist sowohl eine spezifische Suche nach Titel, Personen, Jahr usw. möglich als auch eine Volltextsuche beispielsweise nach einem Begriff. Die Ergebnisse werden angezeigt und sind verlinkt: So kann man von einem Treffer leicht andere Filme einer Regisseurin, eines Regisseurs oder einer Produktionsfirma finden. Die Ergebnisse zeigen die Vielfalt der Themen und Stile des dokumentarischen Films. Im Mittelpunkt stehen nicht nur bekannte Produktionen, sondern beispielsweise auch kurze Formate oder Auftragsproduktionen.
Das DFG-Forschungsprojekts wurde zwischen 2012 bis 2019 von Ursula von Keitz (Filmuniversität Babelsberg, Filmmuseum Potsdam), Thomas Weber (Universität Hamburg) und Kay Hoffmann (Haus des Dokumentarfilms) sowie zahlreichen Mitarbeiter*innen durchgeführt wurde. Es folgte dem Vorgängerprojekt „Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland 1895-1945“, dass seine Ergebnisse 2005 in einer dreibändigen Buchausgabe im Reclam Verlag veröffentlichte. Die Arbeit an der Datenbank kann dabei modellhaft stehen für eine groß angelegte filmhistorische Erfassungsarbeit mit Partner*innen aus Kultur, öffentlichen Institutionen und Journalismus. Ausgewertet wurden dabei zunächst in großem Umfang Filmfestivalkataloge (Berlinale, München, Leipzig, Duisburg, Mannheim, Kassel), thematische Herausgeberschaften wie die des AID Infodienstes, Datenbanken wie die der SPIO sowie zentrale Filmpublikationen wie dem seit 1947 existierende Filmdienst oder die vom Deutschen Institut für Filmkunde herausgegebenen Kataloge der deutschen Kultur- und Dokumentarfilme, die den Zeitraum bis 1959 abdecken. Im Anschluss erfolgte, unter anderem mit Partner*innen wie dem Filmportal.de eine mehrjährige Erschließungsphase, in der die noch vorhandenen Filme in Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv-Filmarchiv, dem Haus des Dokumentarfilms oder dem LWL Medienzentrum gesichtet und beschrieben wurden. In ihrer Archivierung und Veröffentlichung der Filmdaten ist die Datenbank dabei nicht nur als Beitrag zum deutschen Filmerbe gedacht, sondern ist auch ein konkretes Anwendungsbeispiel für eine Erhebung und elektronische Implementierung großer geisteswissenschaftlicher Datenmengen im Sinne der Digital Humanities.
Auf der Website finden sich darüber hinaus Informationen und Artikel rund um das Projekt; seine Geschichte, Mitarbeiter*innen, Artikel sowie Links zu wichtigen Institutionen und Akteuren. Eine große Hilfe kann die von Jeanpaul Goergen zusammengestellte Chronologie des deutschen Dokumentarfilms sein.
Die Redaktion der Website will die Datenbank weiterhin pflegen und ist offen für Anregungen zur Ergänzung, Korrektur und Erweiterung der Datenbestände, kann aber auf Grund eingeschränkter Ressourcen die Umsetzung nicht immer zeitnah garantieren. Die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse in Buchform ist für 2021 geplant.