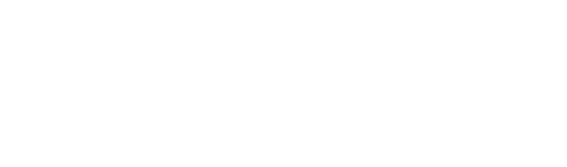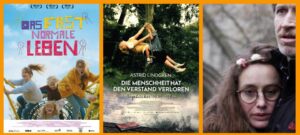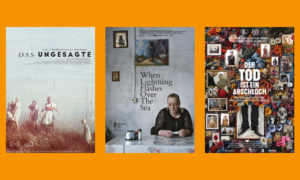Der einfache Bürger – das scheinbar unbekannte Wesen. Wie man mit Stammtischgesprächen und Nebenbei-Interviews viel über das Denken, das Trinken und die Träume erfahren kann, zeigt Filmemacher Dieter Schumann (u.a. »Wadans Welt«, 2010) in seinem jüngsten Dokumentarfilm »Neben den Gleisen«. Der NDR zeigte den im April auch in den Kinos gelaufenen Film am 17.10.2017 in Erstausstrahlung. Nun ist er für ein paar Tage in der Mediathek abrufbar.
Er wisse eigentlich nicht, wieso er hier noch herumhänge, sagt einer beim Bier. Das Bier gehört immer dazu. Stets aus der Flasche, allzeit griffbereit. Manche habe auch schon ein paar gekippt und vermutlich mit ein paar Kurzen nachgelegt. Doch wir befinden uns in Dieter Schumanns Dokumentarfilm »Neben den Gleisen« nicht unter Alkoholikern – obwohl manche der Protagonisten auch diese Diagnose bekommen würden. Neben Diabetes, Niedergeschlagenheit, Arbeitslosigkeit und Wut. Gegen die letzten beiden Diagnosen gibt es leider kein Rezept, keine Tabletten. Wir befinden uns hier ganz dicht mit dem Ohr am Maul des Volkes. Am »Wir sind das Volk«-Volk des Jahres 2017, muss man sagen. Wenn einer den Arm zum Hitlergruß hebt, was in diesem Film nicht passiert, hat er in der anderen Hand eine Flasche Bier.
Neben den Gleisen (NDR-Mediathek)
(Videos voraussichtlich abrufbar bis 24. Oktober 2017)
Boizenburg (Elbe) ist ein Kaff in Mecklenburg-Vorpommern. Knapp 10.000 Einwohner groß und an der Bahnstrecke Berlin-Hamburg gelegen; angeblich innerhalb der Metropolregion Hamburg. Nun, nach Metropole sieht es in Boizenburg nicht aus. Einer der Stadtteile heißt Heide, einer Streitheide und ein anderer einfach nur Vier. Einfach und direkt ist man in Boizenburg. 18,6 Prozent haben bei der Bundestagswahl der AfD ihre Stimme gegeben. Aber es gibt den Bahnhofs-Kiosk von Bernd Fischer. Hier wird getrunken und gequasselt. Auch über Politik. Natürlich hört man die Parolen der Rechten zuhauf an Fischers Kiosk. Irgendwie scheint die Bierfahnenradikalität aber keine Frage der Einstellung zu sein; eher eine Sache des Nachredens, des Dazugehören-Wollens.
Filmemacher Dieter Schumann hat es mit Fragen, Beharrlichkeit und vermutlich auch dem einen oder anderen Bier, das er mittrank, geschafft, für eine Zeit auch dazuzugehören und zuhören zu dürfen. Im Kiosk – in anderen Gegenden der Republik eher als Kneipe bekannt – hört er sich Geschichten und Bekenntnisse an. Das sind keine feinen Gespräche, Weniges ergibt einen tieferen Sinn. Schumann erweist sich indes als durchaus angenehmer Frager, der statt journalistischem Biss das Instrument der Aufmerksamkeit nutzt.
Viele Menschen haben einfach Wut im Bauch, die sich mit dem Alkohol zu einem gärigen Gemisch verbindet. Doch hinter manch herausgepoppter Meinung verbirgt sich tiefe Ideenlosigkeit. Als in Boizenburg Flüchtlinge auftauchen, sind die schnell jene, denen man alles schenkt, die alles bekommen. Die sind die und wir sind wir. Wir, das Volk. Leider gelingt es dem Film nicht, eine wirkliche Verbindung zwischen Flüchtlingen und Kioskbesuchern herzustellen. Das Filmteam dokumentiert zwei sich sprachlos gegenüber stehende Welten. Die eingestreuten Interviewsequenzen mit den Flüchtlingen sprechen dennoch für sich: Hier können sich Menschen über alle Sprachbarrieren hinweg ausdrücken. Die anderen machen noch eine Flasche auf.
Mit den Boizenburgern, von denen die meisten auf den kleinsten gemeinsamen Nenner alles setzen – nämlich auf den, in Deutschland geboren zu sein; oder zumindest in einem Stadt namens DDR, der mal Deutschland im Namen hatte – ist die Verständigung ungleich schwieriger. Aber sie trägt dennoch Früchte Der eine etwa, der feststellte, dass er hier einfach nur noch ohne Sinn herumhänge, erzählt dann noch von seinem einzigen Urlaub. Florida musste es sein – weil er ein absoluter Fan der TV-Serie »Miami Vice« war. Jetzt hofft er, dass vielleicht ein Engel kommt, der ihn hier herausholt. Blond gelockt oder mit schwarzen Haaren. Denn verlieben könne man sich ja immer.
Solange es Träume gibt, ist Boizenburg nicht verloren.