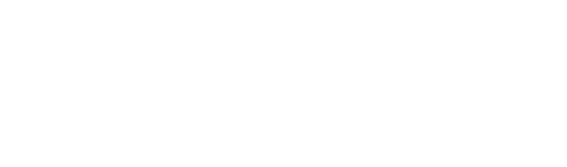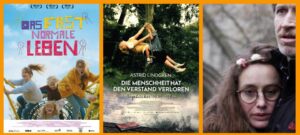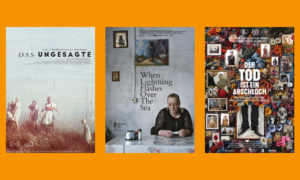Regina Schillings Dokumentarfilm »Titos Brille« lebt ganz von seiner Protagonistin Adriana Altaras, einer Schauspielerin und Regisseurin. Sie entrollt die Geschichte ihrer Eltern, die zunächst an der Seite des späteren jugoslawischen Diktators Tito kämpften, dann aber des Land verlassen mussten. An diesem persönlichen Erbe knabbert »die Partisanentochter« noch heute – und macht sich mit dem alten Mercedes des Vaters auf den Weg, die Familiengeschichten zu entwirren, die viel mit der europäischen Geschichte der Nachkriegszeit zu tun hat. Erzählt wird diese Reise mit viel jüdischem Witz. Der SWR wiederholt den Film am Donnerstagabend.
SWR, 23:45 Uhr: Titos Brille
»Mein Vater war ein Held«, sagt Adriana Altaras. Und »meine Mutter war auch eine Kämpferin«. So beginnt Regina Schillings Dokumentarfilm »Titos Brille« und man ist in wenigen Sekunden mittendrin in einer Familiengeschichte, die man durchaus auch als großen europäischen Nachkriegsepos hätte erzählen und verfilmen können. Adriana Altaras, die heute mit ihrem deutschen Mann (»eine deutsche Eiche«) und ihren beiden Söhnen in Berlin lebt und, wie sie sagt, »an einer Überdosis Vergangenheit leidet«, bricht zu Beginn des Filmes mit dem 35 Jahre alten Mercedes ihres Vaters auf, um über Berlin, Gießen, Italien und schließlich Kroatien die »bösen Geister, die einen nicht schlafen lassen« zu vertreiben. Die Partisanentochter will hinter Familienlegenden blicken – unter anderem hinter die, wieso ihr Vater angeblich dem späteren jugoslawischen Diktator Tito dessen Brille reparierte, woraufhin der eine wichtige Schlacht gewann. Dabei hatte Tito gar keine Brille.
Auch andere Geheimnisse der Eltern werden fast nebenbei gelüftet. Mal geht es um eine Geliebte – natürlich blond -, dann wieder darum, wieso die Eltern fliehen mussten aus dem Land, das sie selbst mit ermöglicht hatten. Die Handung pendelt zwischen privater und geschichtlicher Erinnerung. Was ist wahr am Erbe und muss man ein Erbe, von dem man nicht weiß, wieviel Wahrheit darin steckt, überhaupt annehmen? Damit spielt dieser Film, der auf vielen Ebenen ganz impulsiv, mitunter sehr komisch, aber auch immer weiter hinterfragend seinen Geschichten nachgeht. Es ist nicht nur die Geschichte der Eltern oder jener der kommunistischen Partisanen, es ist auch die vom jüdischen Überleben und einem Neuanfang – ausgerechnet in Deutschland.
Ab und zu verschlägt einem der Witz von Adriana Altaras die Sprache. Zum Beispiel, wenn sie ein Telefonat mit ihrem älteren Sohn kommentiert: »Was ist schon die Pubertät gegen den Holocaust.« Das politisch höchst unkorrekt – aber gut, es ist auch ungemein witzig.
Titos Brille
Dokumentarfilm, D 2014, 94 Minuten
Regie: Regina Schilling
Produktion: zero one filmKoproduktion: SWR
Foto: Szene aus »Titos Brille« © SWR/Zero One