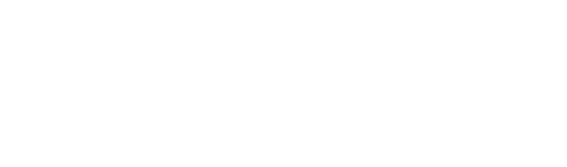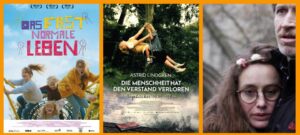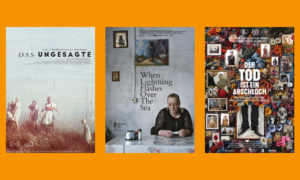Solange Flüchtlinge nur Zahlen sind, ist die Sache einfach. Menschen, die aus Nummern bestehen, kann man aufnehmen, verwalten, abschieben. Man kann sie aufeinander auftürmen zu einer monströsen Überzahl, die einem wie eine Flutwelle vorkommen mag, die sich Bahn bricht. Der Dokumentarfilm »Sklavinnen des IS – Suche nach Gerechtigkeit« von Philippe Sands und David Evans gibt einigen der Nummern ihre Namen und ihre Stimme zurück. Sie erzählen von einem Verbrechen gegen die Jesiden in unseren Tagen und ziehen bewusst eine Verbindung zu den Nürnberger Kriegsprozessen. Er ist noch bis 25. Juli 2018 in der Mediathek von Das Erste zu sehen.
Entführt, geschlagen, vergewaltigt, verkauft, wieder verkauft, noch einmal verkauft. Was die beiden jungen Frauen über ihr monatelanges Leid berichten passt nicht zu ihrem heutigen Erscheinungsbild. Es sind zwei ruhige, starke Frauen, denen man ihre Misshandlungen nicht auf den ersten Blick ansieht. Umso furchtbarer wirkt das, was Luisa und Shirin im sicheren Deutschland von ihrer Heimat im Irak berichten. Wie ihre Familie auseinander gerissen wurde, wie sie selbst in Gefangenschaft gerieten und immer wieder von Soldaten und Symapthisanten des IS missbraucht wurden. Oder wie eine von ihnen das Kind, das sie erwartete abtrieb, in dem sich sich schwere Steine auf den Bauch legte. Wie kann man das nur ertragen? Wie kann man das nur überleben?
Aber das sind nicht die Fragen, die dieser Dokumentarfilm von Philippe Sands (einem bekannten politischen Autor) und David Evans (einem vielfach prämierten Filmemacher) aufwerfen will. Er geht weiter. Eine der Fragen, die sich wirklich aufdrängen, wäre: Wie kann man da nur wegschauen. Und die alles entscheidende Frage schließlich: Wie werden diese Verbrechen an der Menschlichkeit verfolgt? Wird man im Irak, wo diese Verbrechen geschahen, zur Tagesordnung übergehen? Und was heißt das – Ordnung; in einem zerstörten Land mit zerstörten Menschen?
»Sklavinnen des IS – Suche nach Gerechtigkeit« (Das Erste Mediathek)
(Video laut Sender abrufbar bis 25. Juli 2018)
Der stellenweise kaum zu ertragende Dokumentarfilm – wobei sein Grauen nur in den Erzählungen als Horror-Kopfkino stattfindet – zeigt die Arbeit des jesidisch-deutschen Psychologen Dr. Jan Kilhan. In Baden-Württemberg behandelte der Traumatologe seit 2015 mehr als 1000 jesidische Frauen, die Opfer von systematischen Vergewaltigungen und sexueller Sklaverei in ihrer Heimat geworden waren. Ein Verbrechen, das als Völkermord zu verstehen ist, denn das Ziel der Täter des »Islamischen Staats« war es, zusätzlich zur Triebbefriedigung die Frauen und mit ihnen ihre Familie für immer zu zerstören. Nach ihrer Befreiung aus der Gefangenschaft wählen viele Opfer den Selbstmord, weil sie das Gefühl haben, ihre Ehre verloren zu haben.
Der Dokumentarfilm begleitet zwei starke Protagonistinnen auf einem Weg zurück in ein Leben – es normal zu nennen, wäre vermessen. Aber es könnte ein Leben sein ohne Bedrohung, aber vielleicht ohne Heimat. »In den Irak will ich nie mehr zurück«, sagt eine der beiden, nachdem sie ihre Familie in der Heimat wiedersah. Die Zerstörungen materieller und emotionaler Art wirken länger.
In einer weiteren Ebene widmet sich der Film der Frage, wie die Verbrechen heute, nachdem der IS aus den Jesiden-Gebieten vertrieben wurde, mit den Tätern umgegangen wird. Die beiden Autoren stellen dabei eine bewusste Verbindug zu den Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozessen nach 1945 her.
Bei aller Dramatik des Themas, endet der Filme mit leiser Hoffnung. Die jesidische Tradition im Irak, eine der ältesten Gemeinschaften in dem Land, wird sich ändern müssen, um zu überleben. Nach der bisherigen Tradition dürfen die Männer und Frauen nur innerhalb ihres Glaubens heiraten. Für eine Gemeinschaft, die bewusst zersprengt wurde, wäre diese Regel das voraussichtliche Ende. Ein Wandel beginnt mit kleinen Gesten. Zum Beispiel mit jener, als der oberste Glaubensführer einer der missbrauchten Töchter seines Volkes die Hand auflegt. Es gibt noch Hoffnung – aber nur auf ein Leben ohne Normalität. Aber, was ist schon normal in dieser Region und in dieser Zeit?